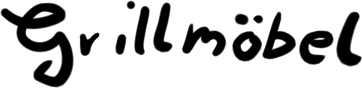22 Jun 2019
fight for my laugh
Der Gesangsstil gefällt mir nicht, das merke ich sofort. Nur warum, weiß ich nicht. Er singt nicht so überkandidelt wie Ed Shiran oder wie der Typ heißt, was das angeht, bin ich zufrieden, aber dennoch scheint es eine Eigenart von Solisten mit Gitarre zu sein, dass sie sehr künstlich klingen, wenn sie versuchen, Gefühl in ihre Stimme zu legen. Die Lösung ist einfach: Es braucht einen persönlichen emotionalen Bezug zu dem Lied, das man spielt. Das ist zB bei einem Massenhit wie „Wish you were here“ von Pink Floyd nicht gegeben, weil der einfach völlig runtergenudelt ist. Der Verdacht entsteht, dass hier nur ein einfach zu lernender und performender Song als Cover herhalten sollte. Schade. Ich finde ein Cover vor allem dann gut, wenn es eine Adaption ist, also nicht ein einfaches Nachspielen. Nachspielen macht erfahrungsgemäß auch Spaß, aber es geht ja darum, einem Lied, das man mag, das Eigene überzustülpen und das möglichst auf eine Weise, die Sinn ergibt, also rund klingt. Gute Cover sind zB „Last Legs“ (Blackbird Raum) in der Version von Leftöver Crack, „Keep it clean“ (Charlie Jordan) in der Version von den Raconteurs oder „Django“ (Oma Hans) in der Version von Yok.
Anders der Typ, auf dessen Konzert ich nun gelandet bin.
Überhaupt ist aber natürlich das Konzept „langhaariger Typ singt und begleitet sich auf der Gitarre“ auch nicht das originellste. Mag sein, dass ich bereits darauf reagiere. Das ist ja auch gar kein böser Wille; wenn man etwas zehn Millionen mal sieht, nutzt es sich, wenn es nicht zB die immer wieder spannenden Bewegungsabläufe von Feuer, Wind oder Wasser sind, die faszinierend zu finden wohl in unsere Gene eingeschrieben ist, halt ab, da kann der arme Interpret 2 Meter von mir entfernt auch nichts dafür. Sein Gitarrenspiel ist flüssig und sein Instrument hat durch die ganze Show hindurch einen schönen und klaren Klang. Elemente von Improvisation fehlen leider, er zieht das offensichtlich alles so durch wie geplant. Bei „Wish you were here“ verändert er immerhin ein bisschen den Ablauf und fügt eine eigens komponierte Bridge ein, die ganz ok passt und immerhin für etwas Abwechslung sorgt. Er bleibt beim Singen in seiner Komfortzone; auch etwas, was mir nicht so gut gefällt, weil ich darin Angst/Scham vor unsauberer Performance u.ä. sehe. Die meisten Sänger_innen, die ich richtig gut finde, trauen sich, an den Grenzen ihrer Stimmfähigkeiten herumzuprobieren. Darunter finden sich prominente Namen wie Rob Halford, Nina Simone und Claus Lüer von Knochenfabrik, wobei Punkbands wesensgemäß weniger Probleme mit diesem Stilmittel haben. Der Sänger, dessen Konzert ich mir anschaue, ist hier also weniger experimentell unterwegs, wird an den hohen Stellen dann eher nur leise und zurückhaltend, was ich aber auch verstehen kann. Trotzdem versucht er, selbstsicher nach außen zu wirken, was er für mich nicht müsste, aber natürlich ist das das, was diese Gesellschaft erstmal erwartet. Um sich als Sänger_in verletztlich und unsicher zu zeigen, muss man entweder schon ultrabekannt sein oder es zum Konzept werden lassen, also sich genau damit vermarkten, so wie diese Annemariekantorei oder wie die heißen. Naja, aber immerhin versucht er nicht, so ein Image zu verbreiten, denke ich zusammenfassend, als er nach seinem Lied wieder den U-Bahn-Waggon verlässt.